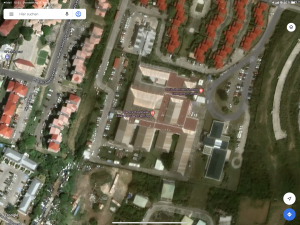Eigentlich begann alles bei der Anästhesie: Zur Vorbereitung auf die Cardioversion, einen Elektroschock, um mein stolperndes Herz wieder in einen ordentlichen Rhythmus zu bringen, sollte ich mich bei der Anästhesie im örtlichen Krankenhaus, dem Centre Hospitalier vorstellen. Nachdem GoogleMaps mich zunächst einmal zum Personaleingang geschickt hatte, an dem Hühner fröhlich auf dem Hof herumpickten, und Eidechsen über den Weg liefen, fand ich mich schließlich am richtigen Eingang ein.
Bei der Anmeldung musste ich auch gleich die heutige Konsultation bezahlen, 70€ war der Pauschalbetrag. Die Anästhesie teilte sich offensichtlich das Wartezimmer mit der Geburtshilfe, denn um mich herum saßen zahlreiche junge Frauen mit extrem runden Kugelbäuchen und mehr oder weniger glücklichem Gesichtsausdruck.
Endlich holte mich die junge Anästhesistin in ihr Sprechzimmer, hörte sich mein Anliegen an … und schickte mich sogleich wieder weg. Sie brauche schon mehr als nur die Diagnose des Kardiologen. Ohne eine Anweisung, was geschehen solle, könne sie nicht arbeiten. Sie betonte immer wieder, dass, sollte etwas mit der Narkose schiefgehen, schlussendlich sie verantwortlich sei. Wer da nun verantwortlich ist, war mir eigentlich egal, es sollte nichts schiefgehen.
Da das Gespräch mit der Anästhesie mindestens 72 Stunden vor dem eigentlichen Eingriff am Donnerstag stattfinden sollte (es war bereits Montag mittag), musste ich mich direkt darum kümmern, denn sonst würde der Termin am Donnerstag platzen. Und dann wäre es erst zwei Woche später, der behandelnde Arzt hat Urlaub nach Ostern.
Glücklicherweise war ich mit dem Auto hier, denn die Praxis des Kardiologen lag auf der anderen Seite von Marigot. Ich bin also geschwind dorthin gefahren, habe Dr. Kirkawi das Anliegen der jungen Frau erklärt, er hat mich zuerst verständnislos angeschaut, um mir schließlich ein Schreiben mit einem Satz und seiner Unterschrift aufzusetzen.
Nun ging es wieder zurück zum Krankenhaus, ich musste es bis vor 13 Uhr schaffen, solange ging die Sprechstunde. In St. Martin ist am Tag immer Stau, denn in den engen Straßen parken entweder Autos auf der Fahrbahn, um schnell mal etwas abzuholen, oder auf jemand zu warten, oder auch nur, um einen Bekannten zu begrüßen. Das stört hier nicht, gehupt wird nur als Dankeschön, zum Beispiel, wenn ein Auto vorgelassen wird. Daher geht tagsüber alles ein bisschen langsamer. Nur die Motorradfahrer schaffen es schneller, denn die drängeln sich elegant in der Mitte der Fahrbahn hindurch.
Aber ich war rechtzeitig dort, und mit dem Schreiben war die Ärztin zufrieden, jetzt hatte sie die Anweisung, die sie brauchte. Nachdem alle Fragen beantwortet waren, bekam ich einen Zettel mit, zum Verhalten vor der OP, und was mitzubringen war, und was auf keinen Fall mitgenommen werden sollte. Konkret: Weder essen noch trinken ab Mitternacht, am Abend vorher und am Morgen duschen (?), Schmuck, falsche Finger- und Fußnägel zu Hause lassen, und pünktlich um 7 Uhr erscheinen, egal für wann der Eingriff angesetzt ist.
Glücklicherweise war ich – entgegen Volkers Rat: „Da sitzt Du doch eh nur rum und wartest!“ – pünktlich dort. Denn die akribische Narkoseärztin hatte leider vergessen mir zu sagen, dass ich einen PCR-Test brauche, um in den OP-Trakt eingelassen zu werden. Ich solle doch mal eben in das Labor fahren, das liegt aber leider direkt neben der Praxis meines Kardiologen, also wiederum am anderen Ende der Stadt. Diesmal hatte mich Volker aber hergefahren, ich hatte also, oh je!, kein Auto hier. Nach Rückfrage war es in Ordnung, wenn die nette Schwester mir den Abstrich abnimmt, das Ergebnis ins Labor schicken lässt und die Ergebnisse per Mail zurückkommen.
So, jetzt hatte ich anderthalb Stunden frei, ich setzte mich draußen vor dem Haus in die Sonne, telefonierte mit Volker, der sich natürlich entsprechend aufregte, las ein bisschen in meinem Buch und beobachtete die Menschen, die ein- und ausgingen.
Als ich mich pünktlich um 10:15 Uhr wieder auf der Station einfand, gab es zwar noch kein Ergebnis aus dem Labor, aber ich wurde trotzdem schon mal in ein Zimmer geführt, wo auf dem Bett das attraktive OP-Hemdchen lag, sowie blaue Plastik-Fußüberzieher und ein – noch – zusammengefalteter Haarschutz. Solange es keine weitere Entwicklung gab, konnte ich mich angezogen in den bequemen Sessel setzen und weiterlesen. Und es dauerte und dauerte, Volker, der ja gerade abwesend war, als die Geduld verteilt wurde, war wieder erbost am Telefon, und selbst ich mit meiner Engelsgeduld drohte sie zu verlieren.
Um 11.25 Uhr kam Dr. Kirkawi und wunderte sich, dass ich noch nicht fertig vorbereitet im OP lag, aber wir mussten ihm leider mitteilen, dass das Ergebnis des Tests immer noch ausstand. „O lala, I have another patient just after you!“ Aber gegen ein fehlendes Testergebnis ist selbst der Doktor machtlos.
Also warte ich weiter, aber nun im OP-Hemdchen, es ist ja warm hier in der Karibik, da macht das nichts aus. Nur die Plastik-Schuhe sind unangenehm, solange hier nichts passiert, lasse ich sie einfach aus, ebenso wie das attraktive Häubchen.
Gegen 12 Uhr rennt freudestrahlend die Schwester ins Zimmer: „Das Testergebnis ist da, es geht los!“ Nun muss nur noch ein Pfleger kommen, der mich in meinem Bett zum OP-Trakt schiebt, gut zehn Minuten, kommt Gary mit den kunstvoll aufgetürmten geflochtenen Zöpfen und einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht. Als er erfährt, dass ich gut französisch spreche, aber Deutsche bin, möchte er ein paar Begriffe lernen, „Guten Tag“, „Vielen Dank“. „Wie geht es Dir?“, „Bitteschön“, etc. Im OP angekommen, spricht er die Begriffe in sein Telefon, um die Sätze demnächst auswendig zu lernen.
So komme ich mit einem Lächeln auf den Lippen im Aufwachraum des Krankenhauses an, wo die Cardioversion durchgeführt werden soll, unter einer ganz leichten Propofol-Narkose. Die Schwestern hier tragen zwar ihre Haarnetze, aber darüber schöne bunte Tücher, und es läuft leise Lounge-Musik. So wird eine entspannte Atmosphäre hergestellt.
Ich werde von einer sehr netten Schwester verkabelt, dann kommen der Anästhesist und der Doktor mitsamt dem „Stromstoß-Gerät“. Zunächst laufen alle etwas ratlos herum, weil die Anschlüsse nicht passen, der Anästhesist immer mit der großen Spritze, in der sich das Propofol befindet. Aber dann kommt eine Schwester, die sich offensichtlich auskennt, holt einen Adapter, und schon geht es los.
Ich versuche mich zu konzentrieren, um genau zu merken, wann ich anfange einzuschlafen, merke noch, wie der Raum verschwimmt, dann bin ich auch schon weg. Wenig später erwache ich aus einem angenehmen Traum, kann mich aber anschließend nicht an den Inhalt erinnern, nur dass es interessant war.
Ein Blick auf den Monitor neben meinem Kopf zeigt mir, dass mein Gefühl richtig war, das Herz schlägt im Sinus-Rhythmus, das Ganze ist geglückt. Die Schwester kommt und fragt, wie es mir geht. „Großartig,“ sage ich mit Blick auf den Monitor, „dann kann ich ja gehen.“ Ich muss leider noch ein bisschen warten, werde aber zwischendurch wieder in mein Zimmer gefahren, leider von einem etwas weniger unterhaltsamen Pfleger, Gary war wohl gerade in der Pause oder auf einer anderen Mission.
Nach einer Dreiviertelstunde bekomme ich einen Zwieback und ein Päckchen “La vache qui rit“, darf gehen, aber nicht ohne vorher an der Anmeldung zu bezahlen, und das war’s.
Trotz aller Pannen war ich sehr froh, mein Buch habe ich fast ausgelesen, der Zweck des der ganzen Aktion ist erreicht, und abgesehen von der Warterei war die Zeit eher unterhaltsam😉.